Vater nannte mich Meister Blitz
Leseprobe
Eine mehrseitige Leseprobe befindet sich untenstehend.
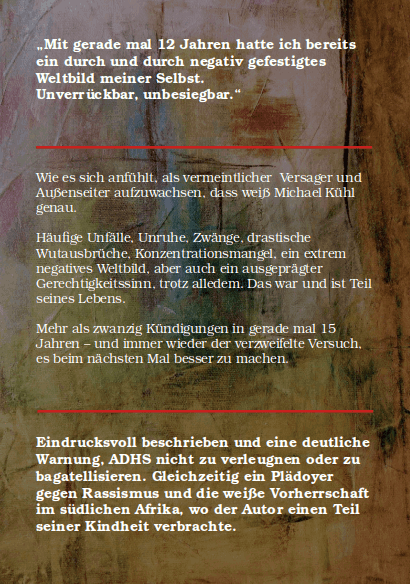
Eine mehrseitige Leseprobe befindet sich untenstehend.
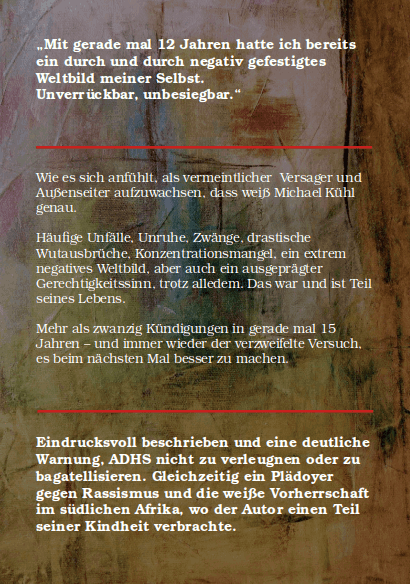
Prolog
Nach einer beeindruckenden Karriere häufiger und spektakulärer Unfälle und zehn Jahren nervenzehrender Schulzeit - für alle Beteiligten - stand ich nun etwas verloren mit meinem Zeugnis da und wusste nicht so recht, wohin. Mutter wünschte mir insgeheim eine Zukunft als Schauspieler im Stil eines Otto Waalkes oder als rasender Reporter, Vater dachte eher an Sportwagenverkäufer. Aber ich hatte wie immer meinen eigenen Kopf.
Über die Jahre glühte immer noch ein typischer Kindheitstraum in mir, und den würde ich jetzt endlich in die Tat umsetzen: Ich wollte zur Feuerwehr, um jeden Preis. Damals war ich allerdings von eher schmächtiger Statur, einäugig aufgrund eines Unfalls in der frühen Kindheit, nicht besonders sportlich, dafür zappelig, impulsiv und ewig abgelenkt, beherrscht von Zwangsgedanken, permanenten Grübeleien und einer fatalen Neigung zu drastischen Wutausbrüchen, wenn etwas nicht auf Anhieb gelang. Und dann ausgerechnet zur Berufsfeuerwehr? Unmöglich.
Der erste Versuch einer Schlosserlehre endete erwartungsgemäß in der Probezeit, und um den Anschluss nicht gänzlich zu verpassen, begab ich mich überstürzt erneut in eine Handwerkslehre … zu einem Malermeister.
Mutter war entsetzt.
"Ach Junge, was soll das denn, du hast zwei linke Hände, das wird doch nie was."
Hätte ich mal auf sie gehört. Mein Ruf für Pleiten und Dramen sollte legendär werden.
Bald traute sich kaum noch ein Kollege mit mir auf das Baugerüst.
Nach mehr als zwanzig Kündigungen, zerplatzten Träumen und gescheiterten Entwürfen in gerade mal fünfzehn Jahren zog ich schließlich die Reißleine, nichts ging mehr. Kurz vor dem völligen Absturz - im Alter von siebenunddreißig Jahren - die klärende Diagnose: Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bis ins Erwachsenenalter hinein. Diese merkwürdige Mischung aus Unruhe, Konzentrationsmangel, extremer Schwarzmalerei und ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn.
Endlich fühlte ich mich nicht mehr lebensunwert. Das nun erworbene Wissen bewahrte mich vor dem Untergang. Ich fing zumindest an, mir selbst zu verzeihen und konnte nach und nach eigenständig die Kontrolle über mein Leben gewährleisten.
Obwohl es sicher manche Menschen mit ADHS gibt, die noch drastischere Lebenserfahrungen machen mussten als ich und später dennoch die aufregendsten Berufe ergriffen und eine glänzende Laufbahn hinlegten, darf mein bisheriger Lebensweg zumindest als bemerkenswert bezeichnet werden.
Kapitel I
Auge um Auge
Aus naheliegenden Gründen mag ich keine Bobby-Cars. Auf Spielplätzen und Hinterhöfen siehst du sie heute gelegentlich noch, im Laufe vieler Jahrzehnte haben sie die Herzen unzähliger Kinder höherschlagen lassen.
Nicht selten wurden durch dieses Spielzeug Berufswünsche angelegt.
Mein bester Freund aus Kindheitstagen etwa - Marc - war es, der mir als späterer LKW-Fahrer bekannte, dass es eben einer dieser Spielzeugwagen war, an den er sich gern zurückerinnere. Bis zu seinem frühzeitigen Ableben arbeitete er mit Leib und Seele als Fernfahrer.
Meiner Tochter habe ich ein Spielzeug dieser Art verwehrt. Und sollten sich irgendwann Enkelkinder ein Bobby-Car zu Weihnachten oder zum Geburtstag von mir wünschen, so hoffen sie vergebens.
Nein, mir hatten diese Plastikfahrzeuge gründlich die Lust am Spielen vergällt, erinnern sie mich doch an den Tag im Jahr 1968, der durch einen Unfall einen bedeutenden Einschnitt in meinem Leben markierte. Dafür kann freilich das Bobby-Car nichts, auch nicht der quietschgelbe Plastik-LKW, um den es hier eigentlich geht, ein Vorläufer des im Jahr 1972 in Fürth entwickelten Spielzeugmodells.
Meine angeborene, stark ausgeprägte Lebhaftigkeit in Verbindung mit mangelnder Ausdauer konnte nur durch immer neu begonnene Aktivitäten gezügelt werden; die Diagnose ADHS war zu der Zeit noch weitgehend unbekannt.
Die für diese Verhaltensauffälligkeit so typische notorische Unruhe entwickelte nach meinem ersten Unfall eine gefährliche Eigendynamik, die weitere Unglücke nach sich zog.
Die Tür zum Wohnzimmer war halb geöffnet, Mutter konnte einen wachsamen Blick in das Kinderzimmer gegenüber werfen, in dem ich mit dem gleichaltrigen Thomas spielte. Wir waren etwa zweieinhalb Jahre alt, entsprechend lebhaft ging es zu.
Unsere Mütter waren befreundet und die Wohnungen befanden sich beide im selben Stockwerk eines Mehrfamilienhauses im Bremer Stadtbezirk Ost.
Wir schubsten uns den Spielzeugwagen, der damals riesig schien, gegenseitig zu, sehr zum Missfallen von Thomas‘ zwei Jahre älterer Schwester Norma, die in einer Ecke mit ihren Puppen und einem schönen alten Kaufmannsladen spielte.
Andauernd raste der Wagen in die Puppen und Stofftiere, die sie dann, schimpfend wie ein Rohrspatz, immer wieder ordentlich in Reih und Glied drapierte.
"Bitte nicht so laut, Kinder, man versteht ja sein eigenes Wort nicht!"
Mutters mahnende Stimme verhallte ungehört. Viel zu sehr waren wir in unser Spiel vertieft, befanden uns in einer Welt aus Fantasie und Abenteuer, in die wohl nur Kinder eintauchen können.
Irgendwann reichte es Norma. Sie versuchte, den Wagen an sich zu reißen. Bei dem Gerangel löste sich die vordere Achse mit den beiden Reifen daran, der Wagen flog scheppernd in eine Ecke.
Thomas hatte nur noch die Achse mit den beiden lose befestigten Reifen an den Enden in der Hand und rollte sie zu mir hin. So ging es längere Zeit hin und her, aber irgendwann löste sich einer der Reifen von dem Draht und verschwand unter einer Kommode.
Da wir uns die Achse nun nicht mehr gegenseitig zurollen konnten, versuchte Thomas, mir den verbliebenen Reifen mit dem Draht voran zuzuwerfen.
Durch ohrenbetäubendes Gebrüll aufgeschreckt, stürmte Mutter ins Kinderzimmer. Entsetzt schaute sie in mein linkes Auge, aus dem Blut und noch eine andere Flüssigkeit liefen.
"Thomas sagt, er will mir die Augen ausstechen", schrie ich, rasend vor Schmerz und Wut.
Norma stand still und blass in der Ecke und hielt eine Puppe fest umklammert. Während Mutter mit mir auf dem Arm, wild um mich schlagend, zum Telefon eilte, um einen Rettungswagen zu rufen, betrachtete die Mutter der beiden Geschwister nachdenklich den Achsendraht mit dem Reifen daran.
Der Stich in meinen linken Augapfel, von den Ärzten als Perforation des Bulbus Oculi bezeichnet, ist mir bis heute präsent, und genauso der besorgte Blick des Notfallsanitäters der Bremer Feuerwehr, der mir mit einer kleinen, aber starken Lampe ins Gesicht leuchtete.
Und Mutter sowieso.
"Jetzt nehmen Sie doch endlich Vernunft an, Sie können da nicht rein, so sind nun mal die Regeln!"
Die Krankenschwester der Augenstation im Krankenhaus baute sich provokativ vor Mutter auf.
Durch eine Glasscheibe beobachteten mich meine Eltern besorgt, wie ich in einem schneeweißen Krankenbett aus hellgrau lackiertem Eisen lag, beide Augen mit einem dicken Verband abgedeckt.
"Wenn Sie jetzt zu ihrem Kind gehen, wird der Abschied nur umso schwerer, wollen Sie das wirklich?"
Der resoluten Frau war nicht begreiflich zu machen, dass eine Mutter ihr Kind niemals freiwillig in einer solchen Situation allein lassen würde.
Mit der Diagnose lebenslange Einäugigkeit wurde ich nach sieben Tagen aus der Klinik entlassen. Es sollte nicht der letzte Aufenthalt gewesen sein.
Ich lief meinen Eltern entgegen, und Vater schenkte mir an diesem Tag meinen ersten Teddybär.
Den obrigkeitshörigen Kadavergehorsam der Oberschwester nimmt Mutter ihr heute noch übel.
Andere Zeiten, andere Sitten.
*
Schon vor dem Unfall mit wenig Ausdauer ausgestattet, musste nun ständig etwas Neues das soeben Begonnene ablösen; nur mit Abwechslung war ich auszugleichen. Die von Geburt an angelegte Zappeligkeit und Ungeduld entwickelte sich nach dem Verlust des Auges zu einem wahren Horrortheater für meine Mitmenschen.
Getrieben von kaum zu bändigender Unruhe und Nervosität, Alpträumen, Aggressivität und der Unfähigkeit, Angefangenes zu beenden, brachte ich mein Umfeld immer wieder an den Rand der Verzweiflung.
Wie von Sinnen raste und zappelte ich unermüdlich durch die Wohnung. Mutter hatte Schwierigkeiten, mich zu fassen zu bekommen, bevor ich wieder irgendetwas umschmiss, auskippte oder noch Schlimmeres passierte. Ständig stieß ich mit dem Kopf gegen einen Türrahmen oder ein Regal, ich nahm die Kurven haarscharf, weil ich mich noch nicht an das nun fehlende räumliche Sehvermögen gewöhnt hatte.
Die permanenten Kopfstöße machten mich rasend vor Wut, und noch heute kommt es vor, dass ich zuhause ein ganzes Wandregal, toll vor Zorn, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen herunterreiße, wenn ich mich daran stoße.
Trotz dieser nach wie vor bestehenden cholerischen Impulsdurchbrüche ist es nie zu Übergriffen auf andere Personen gekommen. Glücklicherweise hielt mich die Angst vor einem erneuten, dann endgültigen Sehverlust davon ab, zu einem gefährlichen Gewalttäter zu werden; die Veranlagung dazu ist, begünstigt durch das ADHS, aber angelegt.
An dieser Stelle scheiden sich die Geister, ob sich meine auffällig gewordene Persönlichkeit auch ohne den Augenunfall so stark herausgebildet hätte oder ob die zunächst noch erträglichen ADHS-Eigenschaften durch dieses Ereignis verstärkt wurden.
Auch nach der Wundheilung, und selbst in viel späteren Jahren blieb meine notorische Unruhe, Ungeduld und Aggressivität bestehen und dauert, wenn auch gemildert, bis heute an. In späteren Beziehungen sollte mir das mehr als einmal vor Augen geführt werden.
Zwei Wochen nach dem Unfall wachte ich nachts schreiend aus einem Alptraum auf und versuchte Mutter entgegenzurennen, die erschrocken in mein Zimmer geeilt kam. Sie hielt die Arme für mich auf - ich wollte auf sie zuspringen. Durch die nun fehlende Möglichkeit, Entfernungen richtig einzuschätzen, rannte ich sehenden Auges in ihre offene Hand und bohrte mir einen ihrer Finger durch den Augenverband gegen den verletzten und noch nicht geheilten, aufgrund des Unfalls ausgelaufenen Augapfel. Brüllend und blutend fuhren mich meine besorgten Eltern sofort wieder ins Krankenhaus, wo ich weitere Tage zur Beobachtung verbringen musste.
Auf Mutters Drängen wurde der Augenverband schließlich um eine Metallplatte erweitert, die mich fortan vor solchen Folgeunfällen schützen sollte, bis ich schließlich eine Augenprothese bekam, ein sogenanntes Glasauge.
Mein Ruf für Unfälle sollte in den kommenden Jahren sprichwörtlich werden.
"Na, Sie waren ja bestimmt schon einen Monat nicht mehr hier, was ist nun wieder passiert?"
In dieser Art sprach mancher Unfall- und Kinderarzt, wenn wir im Wartezimmer saßen, um einen der Unfälle behandeln zu lassen, die die ADHS-typische Unruhe mit sich brachte. Mal fiel ich die Treppe hinunter und stürzte kopfüber durch eine Glasscheibe in ein Rosenbeet, wann anders rammte ich mir eine Harke in den Vorderkopf, auf die ich gefallen war, dann wieder fischte Mutter mich mit Unterkühlung aus einem Flussbett.
Es schien, als hätte ich Blaulicht und Martinshorn für mich gepachtet.
Im Spielzimmer war es verdächtig ruhig, das verhieß selten Gutes. Noch bevor Mutter nach mir sehen konnte, kam ich ihr schreiend entgegengelaufen, im rechten, gesunden Auge hing ein Kleiderbügel aus dünnem Draht.
Bei dem sofort konsultierten Augenarzt wurde ein leichter Kratzer auf der Augapfeloberfläche festgestellt, der zum Glück rasch wieder verheilte.
"Der Junge muss immer seine Brille tragen, immer", rief uns der Augenarzt mahnend hinterher.
Unter der Androhung, mir künftig den Hosenboden zu versohlen, schwor Mutter mich darauf ein, meinen Lebtag nie wieder die Brille abzusetzen.
Die Standpauke wirkte, und bis zum heutigen Tag ist mein erster Griff beim morgendlichen Aufwachen der zur Brille.
Die selbstverständlich nach wie vor aus unzerbrechlichem Kunststoff besteht, nicht aus Glas. Der Grund ist leicht zu erraten.
Noch heute behaupten übrigens einige psychotherapeutischen Fachleute, dass Erinnerungen an die Zeit vor dem dritten Lebensjahr schlichtweg unmöglich seien.
Sie sollten sich gründlich geirrt haben.